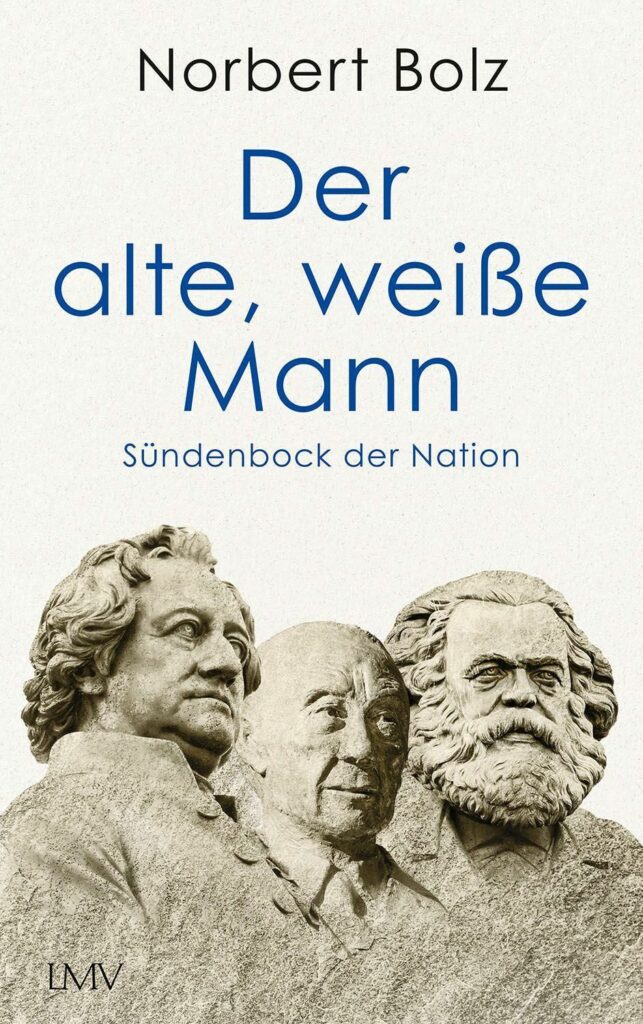Nahezu im Tagestakt erreichen uns Nachrichten, die den Niedergang Deutschlands signalisieren. Sie betreffen fast alle Lebensbereiche. Das verunsichert und bereitet der Welt Angst und Politikverdrossenheit. Ist die offensichtliche Abwärtsfahrt aufzuhalten? Ist die zerstrittene Ampel-Regierung dazu in der Lage?

Foto von Christian Lue auf Unsplash
Der überwiegende Teil der Menschen in unserem Land hat ein recht gutes Bauchgefühl, wenn es um den Zustand des Landes geht. Seit längerem sind sie frei nach Shakespeare gewiss: Es ist etwas faul im Staate Deutschland. Es scheint nur eine Bewegungsrichtung zu geben – abwärts! Deutschland im Niedergang.
In relevanten Rankings rutscht Deutschland mit konstanter Regelmäßigkeit ins Mittelmaß oder noch weiter ab. Beim Wirtschaftswachstum warten laut OECD Indien und China mit 5,4 Prozent auf, Deutschland null! 2019 galt unser Land nach Südkorea noch als innovativstes Land, inzwischen nur noch Rang vier. Als attraktiver Industriestandort findet sich Deutschland auf dem letzten Platz der 20 Industrienationen ein. Die Autoindustrie, Deutschlands Wirtschaftstreiber, hat die Hinwendung zur E-Mobilität verschlafen und verliert vor allem gegenüber China mehr und mehr an Boden. VW als größter Autohersteller der Welt ist auf Platz zwei hinter Toyota abgerutscht.
Wenig Hoffnung verbreiten andere, für ein exportorientiertes Land wichtige Zahlen. Jedes vierte Mittelstandunternehmen denkt ans Aufhören. Fachkräftemangel, hohe Energiepreise, mangelnde Digitalisierung, schwerfällige Bürokratie, hohe Arbeitskosten bewegen Firmen, im Ausland zu investieren. 2022 wurden so 142 Milliarden Dollar ins Ausland transferiert, lediglich elf Milliarden kamen ins Land: ein Minus von 131,8 Milliarden Dollar – so viel wie nie! Die Bedingungen für Investoren sind einfach schlecht: Regulierungslast, Bürokratie, hohe Unternehmenssteuern. 2008 waren die noch die zweitniedrigsten unter den G7-Staaten, momentan die höchsten. Das macht Standorte in Deutschland nicht attraktiv!
Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt. Deutschland baut viel weniger Wohnungen als im Nachkriegsschnitt. Brücken sind marode, die Bahn unpünktlich. Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Gute Laune bei den Steuerzahlern in der viertgrößten Wirtschaftsmacht der Welt macht das nicht. Eher Sorgen. Zumal immer mehr so dringend gesuchte Naturwissenschaftler ihre Zukunft im Ausland sehen: bessere Entwicklungsmöglichkeiten, besserer Verdienst, weniger Steuern, Forschungsfreundlichkeit!
Ein desaströses Bild liefert auch das Bildungswesen im Land der Dichter, Denker und Ingenieure. Beschämend der gefühlt seit Jahrzehnten bestehende Lehrermangel! Seit der ersten PISA-Studie 2001 und dem folgenden Schock wird laut lamentiert, Aktionismus versprüht. Spürbar besser ist es eher nicht geworden. Bei der damaligen Studie landeten deutsche Schüler auf den Rängen 22 (Lesen) und 21 (Mathematik, Naturwissenschaften). Die aktuellste Studie mit den Spitzenreitern China, Singapur, Macao und Hongkong weist Deutschland auf den Plätzen 21 (Lesen), 20 (Mathematik) und 16 (Naturwissenschaften) aus. In der aktuellen IGLU-Studie erreicht ein Viertel der getesteten Grundschüler nicht den Mindeststandard beim Lesen. Die Ausstattung und Nutzung digitaler Medien in Grundschulen sind im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich, die Gebäude bröckeln. Die Folge: Ausbildungsbetriebe beklagen die mangelnden Grundkenntnisse der künftigen Lehrlinge, die einmal Träger der Wirtschaft sein sollen.
Das der Niedergang unseres Landes systemisch ist, belegt auch ein Blick in einen Nebenbereich. Auch im Sport waren wir mal viel besser. 1992 bei Olympia in Barcelona wurde in der Nationenwertung mit 88 Medaillen Platz drei belegt. 2020 in Tokio bei deutlich erhöhten finanziellen Aufwendungen wurden 33 Medaillen gewonnen – Rang neun. Unsere Lieblinge, der einstige Fußballweltmeister Deutschland, ist auf Platz 15 der FIFA-Rangliste zu finden, hinter den USA, der Schweiz, Marokko und Mexiko auf den Plätzen zehn bis 14.
Besserung scheint kaum in Sicht. Die Bundesjugendspiele für Grundschüler (und bald auch an weiterführenden Schulen?) sollen abgeschafft werden, weil Leistungsanforderungen an Kinder nicht mehr zeitgemäß seien. Nach der Devise mehr Life, weniger Work!
Das alles registrieren die Menschen. Sie wissen, dass der momentan noch vorhandene Wohlstand durch Mühen, Anstrengen, kurz Work und nicht durch Life geschaffen wurde. Sie ahnen (und sehen es beim Blick ins Portemonnaie), dass er dahinschmilzt. Corona-Krise, Inflation, Russlands barbarischer Krieg gegen die Ukraine, Flüchtlingsströme, Globalisierung. Computer schicken sich an, schlauer als wir zu werden und Jobs zu übernehmen. Das produziert Gereiztheit, Unsicherheit, Angst – und Wut. Bei alledem fehlen jegliche Antworten und Zukunftsbilder aus der Politik in einer sich ändernden Welt. Das Tempo geben längst die USA und Asien vor. Europa hat an Boden verloren und muss sich seine Rolle neu suchen. Wohin geht Deutschland?
Und welches Bild liefert die Regierung, von der klare Antworten erwartet werden? Die Ampel ergeht sich in Streitereien und frustriert die Bürger ob fehlender Lösungsfähigkeiten. Die Parteien kreisen um sich selbst, um Posten, ihre ideologischen Fundamente und verspielen damit das Vertrauen in die Politik. Beleg dafür ist der Mitgliederschwund der Volksparteien, die so nicht mehr genannt werden dürften. Die einst stolze SPD verlor von 1990 bis 2021 gut 650.000 Mitglieder auf nun 293.000, die CDU im gleichen Zeitraum 405.000, ist jetzt bei 380.000 angekommen. Ausdruck von Entfremdung und Politikverdrossenheit, auch bei demokratisch gesonnenen und engagierten Menschen. Auf dem flachen Land gibt es längst für alles Mögliche Wählerverbindungen für oder gegen etwas –Ortsgruppen etablierter Parteien muss man mit der Lupe suchen. Wie sollen sie da gewählt werden?
Die großen Kulturen der Weltgeschichte, ob Inkas, Griechen, Ägypter, Römer sind nicht an Kriegen zugrunde gegangen. Nach einer von der NASA mitfinanzierte Studie droht einer Gesellschaft der Kollaps, wenn sie die vorhandenen natürlichen Ressourcen übermäßig plündert und zugleich in eine reiche Elite und arme Massen gespalten ist. Denn die Eliten an den Hebeln der Macht sind als Letzte von den Folgen betroffen und würden es deshalb versäumen, rechtzeitig umzusteuern. Stattdessen ergehen sie sich in Eitelkeiten und Nebensächlichkeiten. Das nennt man Dekadenz.
Steuert Deutschland sehenden Auges in den Untergang? Ist die Talfahrt noch zu stoppen?
Alle führenden Wirtschaftsinstitute sind sich einig: Noch hat unser Land das Potenzial, den Trend zu stoppen und umzudrehen. Doch dafür bedarf es auf den entscheidenden Gebieten eines Doppel-Wumms.
Auch wenn unser Land nur drei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verursacht, steht der Einsatz gegen den Klimawandel an oberster Stelle. Das ist unsere Verpflichtung der Welt gegenüber. Er muss konsequent angegangen und mit seinen notwendigen Schritten klar erklärt werden. Es geht aber nur im Einklang mit der Hinwendung zu den zentralen A-Themen Digitalisierung, Infrastruktur mit Energiewende und Ausbau der Netze, Entbürokratisierung und Bildung, sofort und mit aller Finanzkraft! Ich würde dafür auch Schulden aufnehmen.
Die Absicht, viele Lebensbereiche der Menschen im Land nach dem eigenen Weltbild zu gestalten, sollte hingegen schnellstens zu den Akten gelegt werden. Vorschriften wie sie schreiben, sprechen, essen sollen, haben die Leute satt. Ebenso die von großstädtischen Eliten ins Zentrum der Politik und medialer Darstellung gerückten Deutungskonflikte zu Identitätsfragen wie kultureller Aneignung, freie Geschlechterwahl beim Standesamt und das Behandeln von Transsexuellen. Ja, alles beachtenswert. Ja, jeder nach seiner Façon. Aber der Pudel muss wieder vom Kopf auf die Beine gestellt werden. Minderheiten müssen allen Schutz, Hilfe und gleiche Rechte erhalten. Doch sie dürfen damit nicht der großen Mehrheit wie bei den Bundesjugendspielen, die den Vergleich, den Wettbewerb lieben, nicht den Spaß am Wettkampf oder anderen die Freude an einem Schnitzel und anderen wieder an einer Rasterfrisur nehmen.
Es gab mal Zeiten in unserem Land, da sprach ein Bundespräsident ein (notwendiges) Ruck-Machtwort. Es wäre wünschenswert, wenn der jetzige der Streithammel-Ampel-Regierung schnellstens kräftig den Kopf wäscht und ihr mitteilt, wozu sie gewählt ist: Für das Wohl des Volkes zu sorgen – des ganzen! Nicht nur für einen kleinen Teil und schon gar nicht für das eigene (oder ihrer entsprechenden Partei).